Ocrelizumab (Ocrevus®) ist ein monoklonaler Antikörper und gehört zur Gruppe der sog. B-Zell-depletierenden Therapien, die aktuell für die Immuntherapie der Multiplen Sklerose eine sehr große Rolle spielen. Entsprechend häufig werden sie eingesetzt. Hier geht es um mögliche Nebenwirkungen der Ocrelizumab-Therapie.
Ocrelizumab wird als Infusion in 6-monatlichen Abständen mit einer Dosis von 600 mg verabreicht und bindet an Molekül CD20 auf der Oberfläche von B-Lymphozyten vorwiegend im peripheren Blutkreislauf. Diese Bindung führt zur Aktivierung von Komplementfaktoren und Killerzellen, wodurch die attackierte B-Zell abgetötet wird.
Aufgrund des Wirkmechanismus ist die wichtigste Nebenwirkung von Ocrelizumab die unmittelbar bei der Gabe auftretende Infusionsreaktion. Es kann zu Juckreiz, Hautausschlag, Kreislaufproblemen und Atemnot kommen. In der Regel versucht man jedoch diese Infusionsreaktionen, die direkt mit der Abtötung der B-Lymphozyten zusammenhängen, durch bestimmte Begleitmedikationen zu senken.
Infusionsprophylaxe senkt direkte Nebenwirkungen
Kurz vor der Infusion werden ein fiebersenkendes Mittel, ein Anti-Allergikum und Cortison verabreicht. Mit Hilfe dieser Begleitmedikation werden die Infusionsreaktionen bei den meisten Patienten effektiv abgemildert. Zwar klagen Patienten häufig am Infusionstag über Müdigkeit und Abgeschlagenheit, aber schwerwiegende Infusionsreaktionen werden extrem selten beobachtet. Vielleicht sollte man hier noch anfügen, dass man am Infusionstag (aufgrund der Nebenwirkungen, auch der Begleitmedikation) kein Autofahren sollte und, dass die Infusionsreaktionen meistens bei der ersten Gabe am unangenehmsten sind und im Verlauf eher weniger und milder werden.
Darüber hinaus ist die Gabe von Ocrelizumab, obwohl es ein recht eingreifendes Therapieprinzip ist, sehr gut verträglich. Auch die weiteren Nebenwirkungen sind sowohl in den klinischen Studien als auch in der praktischen Anwendung überschaubar – wenn auch durchaus von Bedeutung.
Corona & Co.
Registerdaten zeigen, dass die Gabe von B-Zell-depletierenden Medikamenten die Infektanfälligkeit erhöhen. Auf Infekte der oberen und unteren Luftwege sollte daher geachtet werden. Während der Corona-Pandemie konnte man auf Gruppenebene beobachten, dass B-Zell-Depletion mit schweren Covid-19-Verläufen assoziiert war. Aufgrund dessen sollten chronische Infektionen vor Therapiebeginn ausgeschlossen sein und unter der Therapie sollte man auf eine erhöhte Infektneigung achten.
In diesem Zusammenhang ist auch wichtig, dass es bei einem gewissen Prozentsatz der Ocrelizumab-Patienten zum Abfall der Immunglobulin G-Fraktion (IgG) im peripheren Blut kommt. Langfristig sollte dieser Wert im Auge behalten werden (s. auch DocBlog Immunglobulinspiegel und B-Zell-Depletion (2)), regelmäßige Kontrollen sind anzuraten.
Anfangs hatte man auch Sorgen wegen des Krebsrisikos bei Anwendung von Ocrelizumab, was damit zusammenhing, dass in der ORATORIO Studie, in die PatientInnen mit progressiver MS eingeschlossen wurden, in der Ocrelizumab-Gruppe deutlich mehr Krebserkrankungen aufgetreten sind. Mittlerweile konnte für ein erhöhtes Malignitätsrisiko bei Anwendung von Ocrelizumab zwar kein Anhalt mehr gefunden werden, dennoch sollte man beim Vorliegen einer Krebserkrankung mit der Anwendung von Ocrelizumab vorsichtig sein.
Regelmäßige Blutbildkontrollen unter Ocrelizumab
Hin und wieder werden relevante Blutbildveränderung bei Gabe von Ocrelizumab beobachtet, und zwar nicht nur eine Erniedrigung der Lymphozyten. Auch andere Blutzellen können betroffen sein. Von daher empfehlen sich regelmäßige Kontrollen des Blutbildes unter der Therapie. Hier sollte vor allem auf die früh auftretende Neutropenie geachtet werden.
Ocrelizumab war der erste B-Zell-depletierende Antikörper, der 2018 in Europa zugelassen wurde und seitdem aufgrund seiner guten Wirksamkeit eine wirksame und (zunächst einmal) eine sichere Alternative zu Natalizumab darstellt. Im Gegensatz zu Natalizumab traten PML Fälle nur sporadisch auf und auch diese meist als sog. Carry-over-PML nach Umstellung von Tysabri. Man sollte sich aber auch vor Augen halten, dass Ocrelizumab erst knapp 5 Jahre flächendeckend für die Therapie der MS angewendet wird und daher auch immer noch neue Erkenntnisse im Hinblick auf die Medikamentensicherheit möglich sind.
Übrigens: Allgemeine Informationen zur immunologischen Therapie der Multiplen Sklerose bietet übersichtlich und neutral „MS behandeln“, eine Wissensplattform der AMSEL.











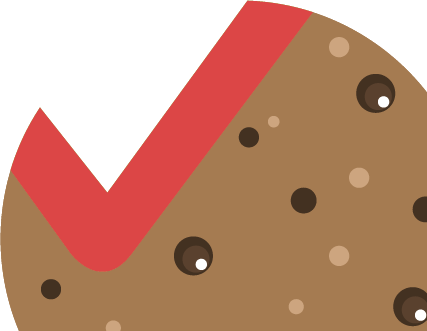
Guten Morgen, ich habe seit 95 MS- eine sehr gut verlaufende Form . Habe 2012. Mama-Ca bekommen . 2019 Ocrelizumap -Im Jahr darauf ein rezidiv des Brustkrebs. Ich bin fest davon überzeugt, dass da ein Zusammenhang besteht.
Ich wünsche allen Krebspatienten dass die medikamentöse Therapie besser auf sie abgestimmt werden.
Mein Mann hat durch Ocrevus einen Leberschaden erlitten. Zwar hat keiner das Kind beim Namen genannt, er hat nach der 2 Ocrevusgabe plötzlich hohe Leberwerte, Flecken am ganzen Körper und Gewichtsverlust gehabt.
Nach vielen Untersuchungen wurde eine PSC diagnostiziert mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit durch Ocrevus, da vor der Gabe alles in Ordnung war.
Ich habe eine SPMS. Ich hatte bisher nur 2 Medikamente (4 Jahre Interferone, 2 Jahre Fingollimod). Es war eine schubförmige MS. Die ED war 1990, ich war 16 !
Ich habe Medizin studiert, bin Dermatologin. Seit 2015 arbeite ich nicht mehr.
Ich war in der Telemedizin in Teilzeit tätig.
Ich habe die Schübe im Studium ignoriert, war nie beim Neurologen. Es gab damals auch keine MS-Medikamente. Erst 2004 Das MRT ist „austherapiert“.
Ich bekomme seit 9 Jahren Rituximab halbjährlich. Eingeleitet wurde Rituximab von der Universitätsklinik Basel. (Prof Kappos) seit 2015 TU München (Prof Hemmer).
Ich bin bei der GKV!
Vor 11 Jahren wollte ich aufgrund einer Kurzsichtigkeit (-3-4 Dpt) die Augen lasern lassen. Aufgrund von „Snow balls“ (chron Uveitis?) wurde ich nicht gelasert.
Ich hatte nie Sehstörungen!
Rituximab wurde bisher „nur“ für max 48 Monate bei den zugelassenen Indikationen
eingesetzt.
Ist eine Umstellung auf Ocrevus sinnvoll?
Die TU München ist zurückhaltend,..
Viele Grüße,
Dr. Isabell Schütze
Ich bin 54 Jahre alt, sekundär progredient, seit 2019 mache ich eine Immuntherape unter Ocrelizumab. Keine Nebenwirkungen. Die MRT-Verlaufskontrolle zeigt, dass keine weiteren Läsionen hinzukommen. Das werte ich als Erfolg. In der Tat reißt mir jeder noch so harmlose Infekt für ein paar Tage die Beine weg und ich liege im Bett. Ataxie und Gangstörung sind meine prominenten Symptome.
Seit meiner Corona-Erkrankung 2022 bin ich auf den Rollator angewiesen, ich kam nicht mehr gut aus dem Bett. Vorher war ich einige Jahre mit Gehstock glücklich. Was ist die Henne, was das Ei? Der Chefarzt der MS-Ambulanz sagte mir das auch nicht. Vielleicht beschleunigte der Virus auch nur, was sowieso vorhergesehen war.